Die ersten universitären Reformvorschläge kamen nicht etwa von den ideologiebewussten Studierenden der Phil.-Hist.-Fakultäten, sondern von Jungakademikern der naturwissenschaftlichen Fakultäten. Sie kamen auch nicht von den jüngeren Semestern, sondern von dem, was man später als «Mittelbau» bezeichnete. Und sie kamen nicht aus dem In-, sondern aus dem Ausland.
|
Uli W. Steinlin - ein 68er?
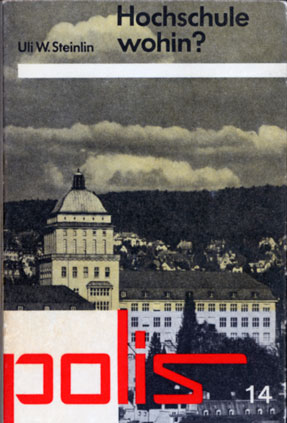
Uli W. Steinlin, Jahrgang 1927, war einer dieser fortgeschrittenen Naturwissenschaftler mit Auslanderfahrung, er war insofern aber ein spezieller Repräsentant, als er mit einer kühnen Schrift zur Frage der Universitätsreform an die Öffentlichkeit trat. Dies schon 1962, also mit35 Jahren. Steinlin, 1954 zum Doktor promoviert, hatte 1962 gerade ebenseinen zweiten wissenschaftlichen Auslandsaufenthalt hinter sich. 1956/58 hatte er eine Assistentenstelle in Berkeley, 1961/62 war er mit einem Stipendium des 1952 gegründeten Schweizerischen Nationalfonds am California Institute of Technology (Caltech). Dort kam es unter einer Handvoll Schweizern zu engagierten Debatten über die Rückständigkeit derschweizerischen Hochschulen. Die Verhältnisse in der Schweiz hätten, soder unerfreuliche Befund, dazu geführt, dass nach den Gesetzen des brain drain ein Teil der helvetischen Intelligenz der schweizerischen Gesellschaft für immer verloren ging. Nach seiner Heimkehr wollte Steinlin einen grossen Artikel in der NZZ veröffentlichen, der Text wurde länger als geplant; über die Vermittlung eines anderen Jungakademikers, des Wirtschaftshistorikers Alfred Bürgin, gelangte er an den Jungtheologen Max Geiger, Mitherausgeber der damals wichtigen Reihe «polis», in der dann auch Imbodens «Helvetisches Malaise» herauskommen sollte.
Steinlin wollte mit seiner engagierten, aber auch fundierten Streitschrift «Hochschule wohin?» wachrütteln und bewusst machen, dass die Leistungsfähigkeit der schweizerischen Hochschulen seit ein bis zweiJahrzehnten nachgelassen habe, und diese zum Teil auf drittrangiges Niveau abgesunken seien. Diese Rückständigkeit sei, so betonte Steinlin,nur zum kleineren Teil durch die schwächere materielle Ausstattung bedingt. Dem Nachwuchsakademiker ging es in erster Linie darum, einer immobilen, von der Vergreisung bedrohten Gesellschaft klar zu machen, «wie sehr wir heute in der Schweiz in einem zusehends beunruhigender werdenden Ungenügen einer altväterlichen Organisation und Auffassung desHochschulbetriebes stecken bleiben, die ohne eine grundlegende Aenderung jeden Versuch zu einer Leistungsfähigkeit ersticken lässt.» Steinlins Kritik galt vor allem der Ordinarien-Universität. Jahre vor der studentischen Protestbewegung wetterte er gegen den «muffig-verstaubten hierarchischen Turmbau des Lehrkörpers», gegen «verkalkte Kleinlichkeit» und «arrogante Ängstlichkeit». Nach einer Reverenz an dievor den grossen und echten Forscherpersönlichkeiten ging er schonungslos mit den «Hochschul-Primadonnen» ins Gericht: «Es gibt da und dort Dozenten [...], die sich selber auf Grund ihrer Stellung in der Rolle einer für ihr Gebiet einzig und allein massgebenden Autorität ansehen und mit einer leichtverletzlichen Empfindlichkeit, die einer launischen Primadonna wohl anstehen würde, eifersüchtig darüber wachen, dass nichts und niemand dieser ihrer Rolle zu nahe tritt und ihre Machtbefugnisse – die als Ordinarius ja oft beträchtlich sind – in etwa beeinträchtigen könnte.» Steinlin empfand es als Widerspruch, dass man sich in der Schweiz etwas auf demokratische Gepflogenheiten zugutehalte und an den Universitäten oligarchische Verhältnisse konserviere, von denen man gemeinhin annehme,dass sie 1798 mit der Alten Eidgenossenschaft untergegangen seien:. «Wir haben den ‹gnädigen Herren› », rief er aus, «bis auf den heutigen Tag an unseren Hochschulen ein Refugium erhalten, innerhalb dessen sich mancher Dozent darin gefällt, mit der Miene väterlichen Wohlwollens und unter dem Mantel der Autonomie der Hochschule, die er zu seinem Schutze anruft, die Spielchen solcher Herrschaftsformen zu geniessen. Und dies ausgerechnet auf einem Gebiete – dem der Lehre, Forschung, der wissenschaftlichen Arbeit –, das solche Autoritätsverhältnisse mit all den Versuchungen, die in einer Primadonnen-Existenz Einzelner und einer in Abhängigkeit von ihren Launen gehaltenen Untergebenenschar liegen, besonders schlecht verträgt.» Soviel zur Kritik. Im Zentrum der konstruktiven Alternativvorschläge standen das Postulat, die schweizerische Universitäten wie die amerikanischen als "departements" und auf der Basis des "team-work" zu organisieren. Er erwartete von dieser Umstrukturierung drei Vorteile: Diese Umstrukturierung hätte die alte Ordinarien-Universität überwinden sollen, in welcher ein einzelner Wissenschafter Lehrstuhlinhaber, Institutsvorsteher und Bezüger von Dienstleistungen sowie Brotherr einerdienstbaren Schar jüngerer Akademiker zu sein pflegte. Steinlins Schrift erregte Aufsehen und löste eine grössere Diskussion aus. Sie wurde aber von studentischer Seite nicht zur Kenntnis genommen.Entweder war sie diesbezüglich, wie man so sagt, ihrer Zeit gewaltig voraus, oder die Studentenpolitiker waren ziemlich hintendrein. Herausgefordert durch den jungen Privatdozenten fühlte sich insbesondereAlexander von Muralt, der damals 60-jährige Ordinarius für Physiologie,ehemaliger Rektor der Universität Bern, mehrfacher Dr. h.c. und erster Forschungspräsident des Schweizerischen Nationalfonds. Die Kontroverse, die hier nicht rekapituliert werden muss, spielte sich auf gehobenerem Niveau in der NZZ ab. Bei einer späteren persönlichen Begegnung war derTon direkter. Paternalistisch erklärte von Muralt, sie hätten alles längst an die Hand genommen, auch ohne dass jemand «dummi Büechli» schreibe. Der Forschungsratspräsident gab zu, daß die Forschungsausgaben gemessen am Nationaleinkommen wesentlich bescheidener seien als in anderen Ländern (bloß ½ Prozent, USA 1,7 Prozent, England 2 Prozent). Er sah aber auch Vorteile in dieser nachteiligen Situation: Die Beschränkung der Mittel könne gerade ein Stimulus für originelle Köpfe sein, der Sparzwang sei «sehr oft» Quelle von unerwarteten Entdeckungen, sofern freilich ein Existenzminimum gewährleistet sei. «Es kommt nicht auf den Käfig an, solange der Vogel singen kann!» Von Muralt verwies aber auch auf «eindrucksvolle» Universitätsneubauten, die als äußeres Zeichen einer erfreulichen Förderung in jeder Hochschulstadt der Schweiz zu sehen seien. Steinlin hielt in seiner Duplik dieser Beurteilung entgegen, daß zum Beispiel in Basel außer ein paar Renovationen und Anbauten in den letzten zwanzig Jahren an Neubauten nur ein großes Chemisches Institut und die kleine Gerichtsmedizinische Anstalt errichtet worden seien und daß von der neuen Universitätsbibliothek erst die Baugrube existiere, obwohl die Verhältnisse schon 1960 «skandalös» gewesen seien. Indessen betonte er nochmals, die Bauten seien nur das «äußere Gewand», das Kernproblem der schweizerischen Universitätskrise liege im personellen und organisatorischen Bereich. Von Muralt warf dem jungen Kollegen vor, er richte seine Forderungen nicht auf die Realisationsmöglichkeiten aus und übersehe die politisch-psychologischen Schwierigkeiten, die mit der Durchführung einer Hochschulreform verbunden seien. Steinlin replizierte, man habe die Reform zu wenig energisch angestrebt, die bereits 1950 als dringlich bezeichneten Postulate seien 13 Jahre später nur zum kleinsten Teil verwirklicht worden, und die Zielsetzung seiner Schrift sei es, die Hochschulkrise «drastisch» darzustellen und der Öffentlichkeit bewußt zumachen. Von Muralt hielt wenig von solchen Debatten vor einem breiten Publikum. Wie weit sein hochschulpolitisches Verständnis vom Diskussionsstil entfernt war, wie er sich nach 1968 einbürgern sollte, zeigt eine Erklärung vom Februar 1964, mit der von Muralt den lästigen Kritiker der schweizerischen Forschungsförderung auf seinen Platz verwies: «In Bergsteigerkreisen kennt man die wahren Alpinisten und unterscheidet sie von denen, die am Fernrohr stehen und zuschauend mit lauter Stimme dem Volk verkünden, die beobachtete Partie komme viel zu langsam vorwärts, sei ungenügend ausgerüstet und befinde sich außerdem auf der falschen Route. Die kleine Gruppe der Männer in der Schweiz, die sich um die Förderung der wissenschaftlichen Forschung und den Ausbau der Hochschulen bemühen, sind so etwas wie Bergsteiger. Wir kennen uns alle sehr gut, wir reden nicht viel, und wir helfen uns gegenseitig durch den Einschlag eines Mauerhakens oder mit einer warmen Tasse Tee, wenn der Wind gar zu eisig bläst. Wir lassen uns weder durch Steinschlag noch durch Kälte und Schwierigkeiten von unserem Ziel ablenken, wenn wir am Berg sind.» Steinlin erfuhr wegen seines hochschulpolitischen Engagements aber keine Beeinträchtigung seiner akademischen Laufbahn. Im Zusammenhang mit seiner Habilitation von 1965 wurde zwar daran erinnert; der Institutschef, ein «feiner, liberaler Deutscher», stellte sich aber auf den Standpunkt, dass dies ein Punkt sei, der weder für noch gegen die Habilitation spreche. |
Suche
Themen
Materialien
Literatur
|
|||



 Seite drucken
Seite drucken